Berufspolitisches
Motion betreffend Prävention psychischer Erkrankungen ab Kindergartenalter und über die gesamte Schulzeit hinweg

Dezember 2024. Der VPB lanciert zusammen mit Grossrätin Fleur Weibel eine Motion betreffend die frühzeitige Prävention von psychischen Erkrankungen. Entsprechenden Präventionsangeboten an Schulen und Kindergärten soll mehr Wichtigkeit zugeschrieben werden. Es sollen insbesondere emotionale Kompetenzen und Kompetenzen der Stressregulation gefördert werden.
Psychische Erkrankungen sind mit grossem Leid für die Betroffenen und deren Angehörigen, aber auch mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. Es steht ausser Frage, dass eine möglichst
frühzeitige psychotherapeutische Behandlung beides – Leid und Kosten – signifikant zu reduzieren vermag. Nur: Aktuell sind kaum freie Psychotherapieplätze vorhanden und es muss mit langen
Wartezeiten gerechnet werden. Hinzu kommt, dass der Bedarf an Psychotherapie seit Jahren wächst. In Anbetracht dieser Entwicklungen wird klar, dass nebst der Förderung einer belastbaren
psychotherapeutischen Versorgung vor allem die Stärkung der Prävention psychischer Erkrankungen von grösster Wichtigkeit ist – und dies in möglichst frühem Alter, insbesondere in der Kindheit und
Jugend.
Die Motion fordert, die psychische Gesundheit bei der künftigen Planung und Koordination der Präventionsangebote an Schulen zwingend als Schwerpunkt zu setzen. Binnen dreier Jahre soll ein
altersstufengerechtes Präventionsprogramm ab Kindergartenalter und über die gesamte Schulzeit hinweg eingeführt werden, welches die Stärkung der psychischen Resilienz durch die Förderung
emotionaler Kompetenzen und Kompetenzen der Stressregulation fokussiert. Dabei soll geprüft werden, wie bereits bestehende Präventionsangebote wie «Start Now»/«Start Now Kids» und «Irre normal»
in das obligatorische Workshop-Programm für die Schüler:innen integriert und wie Lehrpersonen, Eltern und weitere Beteiligte einbezogen werden können. Hier kann der am 19. Dezember 2024 eingereichte
Motionstext gelesen werden. Am 12.
Februar 2025 wurde die Motion mit 61 zu 33 Stimmen dem Regierungsrat überwiesen. Am 11. Juni 2025 wurde der Vorstoss stillschweigend dem Regierungsrat als Anzug überwiesen.
Motion betreffend die Subventionierung der Weiterbildung von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeut:innen

November 2024. Der VPB lanciert zusammen mit Grossrätin Amina Trevisan eine Motion betreffend die Förderung von Psychotherapieplätzen durch die Subventionierung der Weiterbildung von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeut:innen.
In den letzten Jahren hat die psychische Belastung der Schweizer Bevölkerung stark zugenommen. Dem wachsenden psychotherapeutischen Bedarf steht aber nur eine sehr beschränkte Anzahl freier
Psychotherapieplätze gegenüber, was zu langen Wartezeiten führt. Um die Situation kurz- und mittelfristig zu entschärfen, braucht es mehr Psychotherapeut:innen. Dafür muss der Beruf attraktiver
gemacht werden.
Zurzeit müssen sowohl angehende psychologische wie auch ärztliche Psychotherapeut:innen nach ihrem mindestens fünf bis sechs Jahre dauernden Studium die anschliessende psychotherapeutische
Weiterbildung, welche nochmals mindestens vier bis fünf Jahre in Anspruch nimmt, selbst berappen. Diese durchschnittlich etwa 60'000 Franken können in Kombination mit dem langen Ausbildungsweg
von mindestens neun Jahren und dem insbesondere bei Assistenzpsycholog:innen tiefen Lohn abschreckend wirken. Zudem sollte eine psychotherapeutische Weiterbildung nicht nur für privilegierte
Psycholog:innen und Ärzt:innen tragbar sein – eine grössere soziale Diversität unter den Psychotherapeut:innen ist wünschenswert.
Seit 2012 subventioniert der Kanton Basel-Stadt die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) mit 15'000 Franken pro Jahr für eine 100 Prozent Assistenzpsycholog:innenstelle bzw. mit
24'000 Franken pro Jahr für eine Assistenzärzt:innenstelle. Weiterzubildende in Praxen, anderen Kliniken und Institutionen werden nicht subventioniert – auch dies bedeutet eine
Ungleichbehandlung.
Deshalb fordert unser politischer Vorstoss, die psychotherapeutische Weiterbildung für psychologische und ärztliche Assistenzpsychotherapeut:innen niederschwelliger zu gestalten. Es sollen beide
Berufsgruppen gleichermassen und auch ausserhalb den UPK in ihrer Weiterbildung in einem Umfang subventioniert werden, dass für die Weiterzubildenden ein Beitrag von 850 Franken pro Semester,
entsprechend den üblichen Semestergebühren an der Universität Basel, an den Weiterbildungskosten selber zu tragen sind. Hier kann der am 12. September 2024 eingereichte Motionstext gelesen werden. Am 20. November 2024 wurde die Motion dem Regierungsrat überwiesen. Am 9. April 2025 wurde die Motion mit 53 zu 36 Stimmen ein
zweites Mal und damit definitiv überwiesen. Der Regierungsrat ist damit verbindlich beauftragt, die Forderung binnen vier Jahren umzusetzen.
Der VPB setzt sich gegen die Schliessung der Kriseninterventionsstation im Universitätsspital Basel ein

Dezember 2023. Die Kriseninterventionsstation (KIS) der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel bietet Erwachsenen in Krisen niederschwellig einen kurzen stationären Aufenthalt von maximal sieben Tagen mit Arztvisiten und Bezugspflegegesprächen. Die KIS geniesst eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung, den Betroffenen und bei den Zuweiser:innen. Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der KIS war der Standort am Unispital Basel (USB), denn für sehr viele Patientinnen und Patienten ist es bedeutend einfacher, über somatische als über psychische Erkrankungen nachzudenken und zu sprechen – und ebenso ist es für viele leichter denkbar, in einem Spital statt in einer psychiatrischen Klinik Hilfe zu suchen.
Auf Ende 2022 musste die KIS die Räumlichkeiten im USB verlassen, weil der Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Michael Rolaz, CEO der UPK, holte in der Folge die KIS auf den UPK-Campus.
Der VPB hält diese Entwicklung für falsch und ist überzeugt, dass sich dadurch eine Lücke in der gestuften psychiatrischen Versorgung («stepped care») auftun wird. Die KIS auf dem Areal der psychiatrischen Klinik kann Patientinnen und Patienten mit Stigmatisierungsängsten abschrecken, so dass diese Gruppe weniger erreicht und ihr schlechter geholfen werden kann.
Der VPB wehrt sich dezidiert gegen diesen neuen Standort der KIS. Schon 2019 haben wir dem USB, der UPK und dem Regierungsrat geschrieben; im März 2022 haben wir einen Offenen Brief gegen die Schliessung der KIS im USB formuliert und konnten auch den Verband der Psycholog:innen beider Basel und die Fachgruppe Psychiatrie und Psychotherapie BS als Mitunterzeichner:innen gewinnen; seither führten wir verschiedene Gespräche mit Beteiligten und der Grossratskommission für Gesundheit und Soziales; gemeinsam mit der Fachgruppe sammelten wir Unterschriften für einen zweiten Offenen Brief, welchen wir im September 2022 veröffentlichten, und stiessen weit herum in Fachkreisen auf Zustimmung. Bei einer Sitzung mit der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rates am 16. Juni 2022 trafen wir auf offene Ohren. Grossrät:innen u.a. aus der GSK forderten danach mit einer Motion, dass die KIS innert 5 Jahren (oder innert 10 Jahren, wenn dafür konkrete Pläne vorliegen) wieder ins Universitätsspital oder sonst in eine Stadt-Lokalität zurückkehren müsse. Die Motion wurde entgegen dem Antrag des Regierungsrates am 15. Dezember 2022 mit 57 zu 33 Stimmen überwiesen. Schon vorher hatten wir mit Regierungsrat Engelberger und der UPK vereinbart, an der Forschung mitzuwirken, die die KIS während ihrer Zeit auf dem UPK-Campus begleiten soll; wichtig ist uns, zu erfassen, welche PatientInnen den Weg in die UPK finden und welche nicht.
Archiv
Sexuelle Übergriffe in Psychotherapien

März 2023. Sexualität ist ein zentraler Teil des Lebens und oft ein wichtiges Thema in einer Psychotherapie, aber genau deswegen haben
sexuelle Handlungen in einer Therapie keinen Platz. Es liegt zu 100 % in der Verantwortung der Therapeut:innen, dafür zu sorgen, dass alles zur Sprache kommen kann, was die Patient:innen
beschäftigt, aber nur das: Es soll Thema sein, gedacht, besprochen, verstanden und weiterentwickelt werden oder auch als unverständlich, «fremd in mir drin» denkbar werden. Der Raum der
Psychotherapie braucht Schutz vor Handlungen, und die ethischen Richtlinien der Berufsverbände lassen hier keinen Spielraum.
Juristisch gibt es trotzdem Lücken, vor allem, was die vom Strafgesetz erfassbaren Aspekte und die Möglichkeit zur Meldung an die Bewilligungsbehörde betrifft. Immerhin hat das Bundesgericht 1998
und 2004 (BGE 6S.381/2004) Grundsatzentscheide dazu gefällt, die die in einer Psychotherapie entstehende Vertrauensbeziehung sichern. Nach einem unhaltbaren und in der Folge tatsächlich
korrigierten Urteil des Strafgerichts BL versuchten Mitglieder des VPB und der Fachgruppen Psychiatrie Baselland und Basel-Stadt ab Herbst 2003 auf unsere Initiative hin, im Gespräch mit
Richter:innen, Kantonsärzt:innen, Ermittlungsbehörden und Institutionen zu klären, wo der psychotherapeutische und der juristische Gehalt von Wörtern wie Beziehung, Abhängigkeit, Ausnützung sich
unterscheidet und wie das geschützt werden kann, was in einer Psychotherapie geschieht. Mit den Kantonsärzt:innen haben wir ein Verfahren erarbeitet, wie vermutete Täter auch dann zur Rede
gestellt werden können, wenn die Patient:innen den juristischen Weg scheuen. In zwei Veranstaltungen für die Mitglieder aller Verbände haben wir darüber gesprochen, wie wir «unter Kollegen» mit
Grenzverletzungen umgehen und wie wir auf Gerüchte reagieren.
2014 hat die Arbeitsgruppe ihr Mandat an die Vorstände zurückgegeben. 2015 hat die Generalversammlung des VPB beschlossen, in Zusammenarbeit mit ärztlichen
Kolleg:innen eine neue Arbeitsgruppe zu gründen, die dafür sorgt, dass das Thema präsent bleibt und mit Betroffenen nach gangbaren Wegen sucht. Im Februar 2023 veranstalteten wir zusammen mit den
beiden ärztlichen Fachgruppen Psychiatrie und Psychotherapie BS und BL einen Workshop mit dem Titel «Sexuelle Übergriffe in Psychotherapien – bei mir nicht!?», in dem epidemiologische,
juristische, psychiatrische, psycho- und beziehungsdynamische Aspekte zur Sprache kamen. Derzeit arbeiten wir an einer nächsten Veranstaltung, die sich vertieft mit der Beziehungsdynamik zwischen
Patientin und Psychotherapeut befassen wird und mit der Frage, wie kollegiale Intervision Schutz vor Übergriffen bietet.
Unser Angebot an Patient:innen und psychotherapeutische Kolleg:innen bleibt: Wenn Sie uns von erlebten oder vermuteten sexuellen Übergriffen in einer Psychotherapie berichten, versuchen wir mit
Ihnen die Situation zu verstehen, und überlegen, welche Schritte sinnvoll und möglich sind. Schicken Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns auf dem Kontaktformular. Hier können
Sie auch vorerst anonym bleiben, wenn Sie das möchten.
Das Anordnungsmodell ist da

September 2022. Am 19. März 2021 hat der Bundesrat beschlossen, das Anordnungsmodell einzuführen. Psychologische Psychotherapeut:innen mit kantonaler Praxisbewilligung können seit dem 1. Juli 2022 direkt mit der Grundversicherung der Krankenkassen abrechnen, wenn die Anordnung eines Hausarztes, einer Kinderärztin, eines Psychiaters oder einer Psychosomatikerin für eine Psychotherapie vorliegt. Diese Anordnungen gelten zuerst für 15, dann für weitere 15 Stunden; danach braucht es einen ausführlichen Bericht an die Vertrauensärztin der Kasse. Kriseninterventionen (10 Stunden) können von sämtlichen Ärzt:innen angeordnet werden.
Damit entfällt auf Ende 2022 das Delegationsmodell, das seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 in Kraft war – und seit dann umstritten. Es zwang uns gut ausgebildete psychologische Psychotherapeut:innen, uns von einer Ärztin / einem Arzt anstellen zu lassen und unter deren Aufsicht zu arbeiten, wenn unsere Patient:innen auf die Leistungen der Grundversicherung angewiesen waren. Mit der jetzigen, mühsam erkämpften Änderung soll sich der Zugang zur Psychotherapie für viele Leute verbessern. Das Anordnungsverfahren ist allerdings kompliziert, der Tarif zu tief und erst provisorisch – es dürfte in nächster Zeit zu weiteren Änderungen kommen.
Überbrückungsfonds Baselland für Psychotherapien während Corona

Juli 2022. Der Regierungsrat Baselland hat Ende 2021 auf Antrag des VPB 147‘000.– Franken aus dem Swisslos-Fonds gesprochen, um Psychotherapien mitzufinanzieren und zu fördern, die im Zusammenhang mit Corona nötig wurden, aber aufgrund der finanziellen Situation der Patient:innen nicht finanziert werden konnten. Damit sollten mehr Therapieplätze für finanzschwache Patient:innen geschaffen werden, als Überbrückung bis zur Einführung des Anordnungsmodells am 1. Juli 2022.
Der Bedarf an subventionierten Therapieplätzen war aber geringer, als wir gedacht hatten; wir konnten 15 Psychotherapien mit insgesamt Fr. 15'837.30 unterstützen, was für die PatientInnen sehr hilfreich war. Herzlichen Dank an den Swisslosfonds und den Kanton BL!
Runder Tisch des Kantons Baselland «Psychische Gesundheit während Corona»

Mai 2022. Nach einer Anfrage im Landrat Ende 2020 hat der Kanton einen Runden Tisch installiert, der sich mit der psychischen Belastung der Bevölkerung während Corona und der Corona-Massnahmen befasste. Vertreter:innen von gut zwanzig Institutionen der psychosozialen Versorgung trafen sich ab Februar 2021 vier Mal online und tauschten ihre Einschätzungen aus. Drei AG beschäftigen sich mit Jungen, Familien und Alten, wir arbeiteten in der AG Fachpersonen mit: Wie geht es eigentlich ihnen, die die Belastung der Bevölkerung mittragen, und was brauchen sie? Eine zahlreich beantwortete Umfrage zeigte, dass es eine beachtliche Zahl von psychosozialen Profis gab, die im Frühling 2021 am Rande ihrer Kräfte standen – zu einem guten Teil, soweit ersichtlich, weil Austausch und gemeinsame Bewältigung fehlten. Die AG entwarf daraufhin in Absprache mit dem Kanton ein Konzept für den Fall, dass es wieder zu Einschränkungen kommt, und bot im Frühling 2022 vier Gesprächsgruppen an. Keine von ihnen kam zustande, vermutlich weil sie schlicht nicht mehr nötig waren. Das Konzept ist aber so detailliert, dass wir bei Bedarf innert weniger Wochen wieder mit einem Gruppenangebot startbereit wären.
Erklärung des Weltrats für Psychotherapie an die russische Regierung

März 2022. Der Weltrat für Psychotherapie fordert die russische Regierung auf, die Invasion in der Ukraine sofort einzustellen, den Krieg zu beenden, das Völkerrecht zu respektieren und alle russischen Truppen und Waffen in ihr Heimatland zurückzubringen.
Als Psychotherapeuten sind wir der Ansicht, dass eine militärische Invasion niemals Probleme löst und niemals ihre beabsichtigten Ziele erreicht. Stattdessen richtet sie immensen Schaden an und verursacht Zerstörung auf vielen Ebenen, die über Generationen hinweg nachwirken kann. Dazu gehören das persönliche Leid und die tiefen Traumata von Familien und Einzelpersonen auf somatischer, mentaler und emotionaler Ebene. Wir Psychotherapeuten setzen uns für friedliche Verhandlungen, Dialoge und Debatten zur Konfliktlösung ein und verurteilen Krieg und Gewalt. Wir fordern die russische Regierung auf, den Krieg zu beenden und den Frieden durch Diplomatie in einer überlegten und von gegenseitigem Respekt geprägten Weise herzustellen. Wir hoffen, dass sich die höchsten Prinzipien des menschlichen Geistes durchsetzen werden, und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass eine Lösung gefunden werden kann, die die Freiheit wiederherstellt.
Anstellungsbedingungen delegiert arbeitender Psychotherapeut:innen

November 2019. Wir haben mittels einer anonymisierten Onlineumfrage Daten zu Lohn und Anstellungsbedingungen delegiert arbeitender Psychotherapeut:innen erhoben sowie zu deren Zufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen. 116 (54.7 Prozent) der 212 angeschriebenen in Basel-Stadt oder Baselland delegiert tätigen Psychotherapeut:innen nahmen an der Umfrage teil. Die deskriptive Auswertung der verschiedenen Anstellungsbedingungen wird in dieser Arbeit erläutert. Ebenso wird der durchschnittliche Lohn der Befragten berichtet und zwecks Vergleichbarkeit in standardisierter Form veranschaulicht.
Den Delegierten im Stunden- oder Monatslohn (57.1 Prozent der Befragten) werden durchschnittlich 11.3 Prozent (Spannweite 0.3 bis 29.5 Prozent) ihres Bruttostundenansatzes von Fr. 136.05 für weitere, in der Umfrage nicht berücksichtigte Ausgaben – evtl. auch für eine Gewinnbeteiligung der delegierenden Person – abgezogen. Von den Delegierten, die weitgehend autonom ihre Finanzen regeln (42.9 Prozent der Befragten), geben 60.4 Prozent an, weder eine Delegations- noch eine Aufwandspauschale der delegierenden Person entrichten zu müssen. Die restlichen 39.6 Prozent dieser «autonomen Delegierten» geben eine Delegations- und/oder Aufwandspauschale von durchschnittlich 13.1 Prozent (Spannweite 1.5 bis 50.0 Prozent) ihres Umsatzes ab.
Die Zufriedenheit der delegiert arbeitenden Psychotherapeut:innen mit ihren Anstellungsbedingungen zeigt sich heterogen: Während die «autonomen Delegierten» im grossen Ganzen mit ihrem Lohn (im Rahmen der Möglichkeiten des Delegationsmodells), mit der Transparenz der Geschäftszahlen, mit der Arbeitsbeziehung zur und Zusammenarbeit mit der delegierenden Person zufrieden sind, fällt die Zufriedenheit der im Stunden- oder Monatslohn tätigen Delegierten bedeutend niedriger aus. Daraus ergibt sich ein deutlich stärkerer Wunsch der Zweitgenannten, die Anstellungsbedingungen zu verbessern, wobei aber beide Gruppen, die «autonomen Delegierten» wie auch die Delegierten im Stunden-/ Monatslohn, solidarisch eine gewerkschaftliche Organisierung mehrheitlich unterstützen würden.
Wir formulieren Empfehlungen zur guten Delegation, welche eine faire und beidseitig bereichernde Zusammenarbeit zwischen delegierenden Ärzt:innen und delegiert arbeitenden Psychotherapeut:innen fördern sollen. Kontakt
Die ganze Arbeit können Sie hier herunterladen. Und hier die aus der Studie folgenden Empfehlungen, die wir mit unseren Kolleg:innen der psychiatrischen Fachgruppen besprochen haben.
Prävention psychosozialer Belastungsfolgen in der Somatik: Ein Modellprojekt zur kollaborativen Versorgung
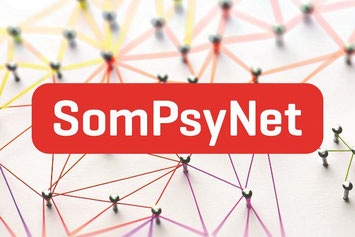
Dezember 2022. Das Forschungsprojekt SomPsyNet wird vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt durchgeführt und von der Gesundheitsförderung Schweiz finanziert. Der VPB gehört zur Fokusgruppe «Schnittstellen», zusammen mit den UPK, Hausärzt:innen, Psychiater:innen, Apotheker:innen. In mehreren Treffen erörterte die Gruppe, wie Patient:innen aus den somatischen Abteilungen in nachgeordnete Behandlungen geleitet werden können (Sozialberatung, IV, Ernährungsberatung, Psychotherapie) und welche Brüche dabei drohen. Im Verlauf des Projektes hat sich einerseits gezeigt, dass sehr viel mehr somatische Patient:innen als ursprünglich angenommen psychosozial belastet sind, anderseits aber auch, wie gross die organisatorischen, finanziellen, konzeptuellen und wohl auch persönlichen Widerstände dagegen sind, die psychische Realität dieser Patient:innen wirklich ernstzunehmen. Das Projekt geht 2023 in eine Art Normalbetrieb über; es ist nicht klar, wie viele der angestrebten Ziele zu erreichen sind. Kontakt und Website SomPsyNet
Psychiatrie-Konzept Basel-Stadt/Baselland
Dezember 2019. Am 24. Juni 2019 stellten die Projektleiter der Gesundheitsdepartemente BS und BL ihren Plan vor, wie bis 2023 ein neues, für beide Halbkantone gültiges Psychiatriekonzept entstehen soll. Nötig wurde es, weil die Stimmbürger:innen im Februar 2019 zwar die Fusion der Spitäler abgelehnt, aber einer gemeinsamen Spitalplanung zugestimmt hatten. Wir haben in der Konzeptgruppe Erwachsenenpsychiatrie mitgearbeitet, und es ist uns gelungen, einige für die ambulante Psychotherapie und die Versorgungskette fundamentale Gedanken einzubringen. Am 12. Dezember haben Basel-Stadt und Baselland das Konzept veröffentlicht. Kontakt
Bündnis gegen Depression Baselland

September 2017. Ebenfalls Partner-Organisation sind wir beim Bündnis gegen Depression Baselland. www.buendnis-gegen-depression-bl.ch
Fokus Psychische Gesundheit Basel-Stadt

Oktober 2010. Der VPB arbeitet in der Fachbegleitgruppe des Aktionsprogramms Psychische Gesundheit Basel-Stadt mit. Es orientiert sich am Bündnis Depression, wie es schon in mehreren Städten läuft. Sein Ziel ist es, psychische Krankheiten zu enttabuisieren und sowohl Betroffenen als auch ihren Angehörigen leichteren Zugang zu Unterstützung zu verschaffen. Neben Plakataktionen gibt's verschiedene Veranstaltungen: Vorträge, Filme, Diskussionen, Konzerte, Lesungen. Näheres siehe www.allesgutebasel.ch
